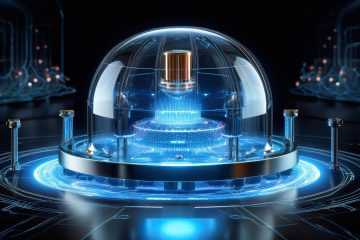Erster Verbandstag von Kerntechnik Deutschland
Am 7. Mai 2025, rund einen Monat nach Vorstellung des Koalitionsvertrages der neuen Bundesregierung sowie am Tag nach der Regierungsbildung fand der erste Verbandstag von Kerntechnik Deutschland (KernD) mit dem Titel „Kerntechnik im Dialog“ als ganztägige Veranstaltung statt. Der KernD-Verbandstag richtete sich an Gäste aus Industrie, Wissenschaft, Politik, Medien und Diplomatie und bot ein hochkarätiges Forum für den sachlichen und offenen Austausch zu aktuellen und strategischen Themen der Kerntechnik.
Im Mittelpunkt standen praxisnahe Vorträge, Diskussionen und persönliche Gespräche – mit dem Ziel, fachliche Expertise, neue Impulse und Ideen zusammenzubringen.

Der Vorsitzende von KernD, Thomas Seipolt eröffnete den Verbandstag und rekapitulierte das Bestreben von KernD in den vergangenen Monaten, argumentativ für eine Wiederinbetriebnahme abgeschalteter Kernkraftwerke durch zu werben. Obwohl dies aufgrund handfester energiewirtschaftlicher und wirtschaftspolitischer Vorteile durchaus in Teilen der Politik auf Resonanz gestoßen sei, sei es doch nicht gelungen, die teils tief verankerten Vorbehalte gegenüber einer neuen Kernenergiepolitik zu überwinden. Er betonte zugleich, dass der Blick in die jüngste Vergangenheit nur einen kleineren Teil des Vortragsprogramms des Tages ausmache, sondern dass vielmehr der Blick in die Zukunft in Deutschland und international im Mittelpunkt stehen sollen, wie er sich in den Themen SMR-Entwicklung, Kernfusion, Endlagerung und Kernenergieprogramm unseres Nachbarlandes Tschechien mainifestiere.
Energiepolitik der neuen Bundesregierung
Als erster Referent des Tages trug Dr. Christian Geinitz, Wirtschaftskorrespondent in der Hauptstadtredaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, zu „Energiefragen Deutschland 2025“ vor. Vor dem eigentlichen Thema der Herausforderungen der Energiepolitik erklärte Geinitz, dass das Durchfallen von Merz im ersten Wahlgang am Tag zuvor nicht einfach ein Denkzettel sei, sondern einen Mangel an Vertrauen sowie an Respekt vor dem Wähler zeige. Es sei ein jammervolles Signal nach innen und außen, das die Feinde der offenen Gesellschaft triumphieren lasse.

Geinitz erklärt, dass er den Ausstieg aus der Kernenergie in Deutschland für falsch halte. Kernenergie hätte aus seiner Sicht mit Unterstützung der Bevölkerung zu wichtigen Zielen im Energiesektor beitragen können wie Wettbewerbsfähigkeit, Klimapolitik, Netzstabilität, Energieunabhängigkeit. Die Energiegewinnung aus Kernspaltung komme aber im Koalitionsvertrag nicht vor, was zwar wesentlich an der SPD gelegen habe, aber auch am Unwillen der Betreiber sowie an mangelnder Entschlossenheit in der Union, ihre Position durchzusetzen.
Der Koalitionsvertrag halte an den klimapolitischen Zielvorgaben fest, obwohl der BDI und andere für eine Verschiebung der Klimaneutralität von 2045 auf das gemeinsame europäische Ziel 20250 plädierten. Dadurch ließen sich 750 Milliarden Euro Kosten sparen, der Ausbau erneuerbarer Energien entspannen, ohne dem Klima substantiell zu schaden. Das Klimaschutzgesetz bleibe aber unangetastet.
Geinitz berichtet, dass ein Monitoring der Energiewende eingeführt werden solle bei dem der Strombedarf, der Ausbau der Erneuerbaren und die Versorgungssicherheit evaluiert werden sollen ebenso wie die Ausbaupläne für die Off-shore Windenergie wegen des Windparkeffekts in der Deutschen Bucht.
Er stellt fest, die neue Koalition habe erkannt, dass über der Umweltfreundlichkeit die anderen Ziele der Energiepolitik vernachlässigt worden seien. Das schon von der Ampelregierung angekündigte Klimageld bleibe aber weiter aus.
Geinitz fährt damit fort, dass die neue Regierung aus seiner Sicht erkannt habe, dass die Versorgungssicherheit ein Schlüsselfaktor sein werde und verweist dabei auch auf den jüngsten Blackout auf der iberischen Halbinsel. Dieser solle durch den Ausbau von Gaskraftwerken zur Deckung des Bedarfs an gesicherter Leistung Rechnung getragen werden. Gaskraftwerke spielten in den Plänen der neuen Regierung auch darüber hinaus eine Schlüsselrolle und sollen nicht nur in der Spitzenlast und unabhängig von der Frage des Wasserstoffeinsatzes genutzt werden. Dafür solle auch die Möglichkeit langfristiger Lieferverträge geschaffen sowie die CO2-Abscheidung bei Gaskraftwerken ermöglicht werden. Diese Punkte seien aber nicht nur bei den Grünen, sondern auch in der SPD sehr umstritten. Geinitz hält fest, dass die Kohlekraftwerke als Rückversicherung verblieben, falls die Gaskraftwerke nicht ausreichend oder nicht schnell genug zugebaut würden.
Er berichtet, die Generaldirektion für Beihilfen der EU-Kommission habe die Solarspitzenregelung wegen einer fehlenden Rückforderungsklausel nicht genehmigt, so dass vermutlich auch bei Plänen der neuen Regierung europäische Genehmigungshürden auftreten könnten.
Er teilt seine Einschätzung mit, dass die Minister Katherina Reiche (Wirtschaft und Energie) und Carsten Schneider (Umwelt) in der Energiewirtschaft positiv eingeschätzt würden. Es werde erwartet, dass sich Reiche stark auf klassische Wirtschafts- und Ordnungspolitik fokussieren werde. Noch keine Einschätzung könne er zur Trennung von Energie und Klima in den Ressortzuständigkeiten geben. Schneider sei bei den Themen seines Hauses nicht unbeleckt, sei aber bisher eher in der Finanzpolitik aktiv gewesen. Er habe Jochen Flasbarth aus dem Entwicklungshilfeministerium ins Umweltministerium zurückgeholt, um als „Haudegen“ in der nationalen und internationalen Klimapolitik zu fungieren.
Insgesamt lasse die neue Regierung nach Geinitz‘ Auffassung in der Energiepolitik Mut vermissen, nicht nur bei der Kernenergie, sondern auch hinsichtlich einer Verschiebung der Klimaneutralität und der Möglichkeit der CCS-Nutzung bei Kohlekraftwerken.
Rechtsfragen neuer Nukleartechnologien
Der nächste Vortrag von Dr. Christian Raetzke, „Rechtsfragen zu neuen Nuklear-Technologien“, behandelt regulatorische Fragen im Blick auf Forschungsreaktoren, Transmutationsanlagen, SMR und Kernfusion.

Raetzke erläutert zunächst die bestehenden Verbote und die fortbestehenden Möglichkeiten für Nukleartechnologien. Bei Kernkraftwerken seien Errichtung und Betrieb zur gewerblichen Erzeugung von Elektrizität verboten, gleiches gelte für Wiederaufarbeitungsanlagen ergänzt um ein Verbot der Abgabe von Stoffen an solche Anlagen. Raetzke fährt mit der Feststellung fort, dass die Kerntechnik ansonsten weiterhin erlaubt sei, sofern Anlagen die erforderliche Sicherheit im Sinne der Schadensvorsorge gewährleisteten. Insbesondere sei das rechtliche „Räderwerk“ für Genehmigungen noch vorhanden, materiell in Form der Genehmigungsnormen sowie verfahrensrechtlich u. a. mit der Atomrechtlichen Verfahrensverordnung.
Raetzke hält fest, dass Forschungsreaktoren von der Beendigung der Kernenergienutzung 2002/2011 ausdrücklich nicht betroffen sein sollten und keinen Strom erzeugten, sondern die Neutronenstrahlung für Zwecke der Forschung, Technik, Medizin nutzten. Auch eine Stromerzeugung als Nebenprodukt künftiger Forschungsreaktoren wäre erlaubt, sofern diese nicht „gewerblich“ erfolge, sondern als Teil der Forschung zu Energiesystemen oder zur Deckung des Eigenbedarfs für den Campus.
In Bezug auf Transmutationsanlagen etwa nach dem Konzept des START-Moduls wie es in einer Studie der Bundesagentur für Sprunginnovation betrachtet worden sei, bestehe eine kompliziertere Lage, wie Raetzke ausführt. Eine Stromerzeugung könne als ein Nebeneffekt der Anlage evtl. gerechtfertigt werden, wäre aber rechtlich unsicher. Da eine solche Anlage auch eine Wiederaufarbeitung beinhalte, sei sie aber von einem diesbezüglichen Verbot erfasst. Hier könne eine gesetzliche Ausnahme vom Verbot der Wiederaufarbeitung in Betracht kommen, besonders wenn diese nicht zur Gewinnung neuen Brennstoffs diene, sondern zur Verringerung von Abfallvolumina und Aktivität zur Entlastung eines künftigen Endlagers. Hinsichtlich der Risikobewertung wäre Raetzke zufolge zu beachten, dass die Anlage ein Restrisikopotential berge, aber zugleich aktiv zur Sicherheit der Entsorgung beitragen könne.
Raetzke führt zum kerntechnischen Anwendungsfall Small Modular Reactors (SMR) aus, dass die Genehmigungsfähigkeit vom Nutzungszweck abhänge. Im Fall von Prozessdampf und -wärme für industrielle Anwendung, Fernwärmenetze und Strombereitstellung für einen integrierten Prozess zur Erzeugung eines anderen Produkts wie Wasserstoff bestünde kein Verbot. Auch die Nutzung von Strom für den Eigenbedarf einer Industrieanlage wäre rechtlich gut vertretbar. Hierbei sei auch eine grenzüberschreitende Variante denkbar, mit einem SMR im Ausland und einer Stromleitung zum oder einem Power Purchase Agreement für den deutschen Abnehmer.
Raetzke erklärt, dass sich für die Kernfusion die Lage aktuell ganz anders darstelle, da diese von der Politik gemäß Koalitionsvertrag erwünscht sei. Die bisherigen Versuchsanlagen in Garching und Greifswald seien nach Strahlenschutzrecht genehmigt worden und im Prozess finde keine Spaltung von Kernbrennstoffen statt wodurch auch kommerzielle Fusionsanlagen vom Verbot nach AtG nicht betroffen seien. Es bestehe zwischen den Regierungsparteien auch Konsens, dass die Regulierung der Kernfusion auch weiterhin nicht im Atomrecht erfolgen solle. Vielmehr sei die Schaffung eines eigenen Genehmigungsregimes geplant, sei es im Strahlenschutzrecht oder in einem Fusionsgesetz.
Im Fazit stellt Raetzke fest, dass das AtG immer noch viele Möglichkeiten für neue Kerntechnologien biete. Vor dem Hintergrund der Verbote bei Kernkraftwerken und Wiederaufarbeitungsanlagen sowie im Licht der Erfahrungen sei aber eine eingeschränkte Investitionssicherheit durch politische und mediale Risiken anzunehmen. Die Zuständigkeit für Anlagengenehmigungen liege bei den Ländern aber es bestehe ein Weisungsrecht des Bundes im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung. Im Hinblick auf die Herangehensweise bei der Nutzung der rechtlichen Möglichkeiten für neue kerntechnische Anlagen empfiehlt Raetzke, nicht auf das Ausnutzen von Lücken im Gesetz abzustellen, sondern ein Bewusstsein dafür zu bilden, dass der gesetzliche Rahmen ein breites Spektrum von Aktivitäten ermögliche, die nicht ausdrücklich verboten seien. In einem möglichen zweiten Schritt könne das AtG gezielt etwa an Transmutation oder SMR angepasst werden. Es sei wichtig festzuhalten, dass es verfassungsrechtlich kein Hindernis für eine Einschränkung oder Aufhebung der Verbote im AtG gebe.
Aktuelles zu Endlager Konrad
Kurzfristig konnte die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) gewonnen werden, über ein in der aktuellen Medienberichterstattung beleuchtetes Thema vorzutragen, das viele der anwesenden Gäste bzw. deren Unternehmen direkt betrifft, das Endlagerprojekt Konrad. Dr. Monika Kreienmeyer und Dr. Bernd Samwer gaben im Vortrag „Konrad aktuell“ zunächst einen Überblick des Projektstandes und die kommenden Schritte der Errichtung des Endlagers für schwach- und mittelradioaktive Abfälle. Danach berichteten sie über die Phase 2 der Überprüfung der sicherheitstechnischen Anforderungen für das Endlager Konrad (ÜsiKo), die darauf gerichtet sei, die Fortentwicklung im Stand von Wissenschaft und Technik seit Erteilung des Planfeststellungsbeschlusses zu untersuchen (Phase 1) und die Sicherheitsanalysen zu aktualisieren (Phase 2). Diese Arbeitsschritte seien nun abgeschlossen und die Ergebnisse seien nach einer unabhängigen wissenschaftlichen Begleitung durch vier Experten bei einer Veranstaltung der Fachöffentlichkeit im Oktober 2024 präsentiert worden. Noch ausstehend seien Phase 3 – mögliche Anpassung der Planung – und Phase 4 – deren Umsetzung im Bau.

Kreienmeyer und Samwer führen aus, dass in Phase 2 10 Hinweise und 36 Deltas identifiziert worden seien, von denen noch 10 Deltas zwischen ursprünglicher Sicherheitsanalyse und Stand von Wissenschaft und Technik zu bearbeiten seien, darunter ein wissenschaftlicher Dissens über Kritikalitätsmodelle und Fragen der Optimierung der Betriebssicherheit. Zentrales Ergebnis sei, dass die Fachgutachten zeigten, dass das Endlager Konrad sicher betrieben werden könne. Auch mit Blick auf die Langzeitsicherheit zeigen die Ergebnisse der ÜsiKo, dass Konrad ein sicheres Endlager werde.
Zur medial aktuellen Fragestellung der Freigabe von Abfallgebinden zur Endlagerung teilen Kreienmeyer und Samwer mit, dass das Volumen radiologisch produktkontrollierter Abfälle in den letzten Jahren gesteigert worden sei. In 2024 seien ca. 8.500 m3 Abfallvolumen radiologisch produktkontrolliert worden. Zugleich gebe es aber derzeit noch keine freigegebenen Gebinde im Hinblick auf die stoffliche Beschreibung, so dass zum heutigen Stand kein Abfallgebinde mit schwach- oder mittelradioaktiven Abfällen im Endlager Konrad eingelagert werden könne. Die Vortragenden erklärten, dass hierfür die Gehobene Wasserrechtliche Erlaubnis (GWE) eine zentrale Rolle spiele. Sie erläutern, dass mit dem Planfeststellungsbeschluss 4 wasserrechtliche Erlaubnisse für Konrad erteilt worden seien, von denen nur eine die Abfälle behandle.
Kreienmeyer und Samwer führen weiter aus, dass radioaktive Abfälle radiologisch und stofflich charakterisiert werden müssten. Die radiologischen Grenzwerte stünden in den Endlagerungsbedingungen fest, womit eine Bestätigung der Endlagerfähigkeit von Abfallgebinden verlässlich möglich sei. Für die stoffliche Charakterisierung lägen aber keine Grenzwerte pro Gebinde vor. Vielmehr müsse die Unbedenklichkeit für das Grundwasser durch die Einlagerung für jeden Stoff in Summe nachgewiesen werden. Die Basis für diesen Nachweis sei das Umsetzungsmodell für die GWE, das vom damaligen Betreiber Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) in Abstimmung mit der zuständigen Wasserrechtsbehörde in Niedersachsen in 2011 ausgearbeitet worden sei.
Weiter erklären sie, dass das Umsetzungsmodell der GWE mit Stoff- und Behälterlisten arbeite, mit denen Abfallgebinde wie in einem Baukastensystem beschrieben werden könnten. Das bedeute, dass der Ablieferungspflichtige einen Listeneintrag beantrage und die BGE als heutiger Betreiber die Unbedenklichkeit des Stoffes prüfe sowie gegenüber dem Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) nachweise. Erst danach könne ein Eintrag zur Verwendung freigegeben werden.
Kreienmeyer und Samwer berichten, dass seit der Änderung der Grundwasserverordnung im Jahr 2017 wegen der Sperrung von Stofflisteneinträgen kein vollständiger Endlagerbescheid für Abfallgebinde mehr habe erlassen werden können. Seit Änderung der Trinkwasserverordnung 2023 seien darüber hinaus nun fast alle Stofflisteneinträge betroffen. Als Folge müsste nun die Unbedenklichkeit von 124 Stoffen aus den Stofflisten in Bezug auf die geänderten Grenzwerte erneut betrachtet werden. Der Verweis auf die dynamischen Grenzwerte des konventionellen Wasserrechts bewirke so, dass auch geprüfte und bestätigte Gebinde ihre Zulassung zur Endlagerung wieder verlieren könnten.
Zu einer möglichen Lösung des Problems führen die Vortragenden aus, dass die BGE überzeugt sei, dass durch die Einlagerung der radioaktiven Abfälle keine unzulässige Belastung des Grundwassers entstehe, so dass die diesbezüglichen Schutzziele zu jeder Zeit eingehalten werden könnten. Dabei sei zu beachten, dass die Einlagerung der Abfälle in etwa 850 Metern Tiefe unter der Erdoberfläche erfolge. Das zugrunde gelegte Ausbreitungsmodell sei mit Überkonservativitäten belastet und gehe gemäß dieser Annahmen davon aus, dass ein Stofftransport zur Oberfläche nach mehreren Hunderttausend Jahren möglich sei. In der Realität würden aber auch Sorptionsprozesse und der Abbau organischer Verbindungen auftreten und die größere Dichte des Tiefengrundwassers müsse berücksichtigt werden. Der tatsächliche Stofftransport bis zur Oberfläche werde dadurch deutlich langsamer sein oder gar nicht stattfinden, so dass weniger bis keine Mengen bestimmter Stoffe überhaupt im Grundwasser ankommen würden. Die Prüfung der Unbedenklichkeit angesichts der geänderten Grenzwerte im Wasserrecht liefen bei der BGE, seien aber noch nicht abgeschlossen. Dabei würden auch die genannten Effekte berücksichtigt.
In der Fragerunde wird angemerkt, das die BGE versuche, ein politisch-juristisches Problem technisch zu lösen, was vermutlich nicht funktionieren werde.
Der Bundestags-Untersuchungsausschuss „Atomausstieg“
Der Investivjournalist Daniel Gräber berichtet über seine Rolle und die des Magazins Cicero bei der Aufklärung über den Umgang mit der Kernenergie und der Entscheidungswege innerhalb der Bundesregierung während der Energiekrise 2022/23 in seinem Vortrag „Cicero und der BT-Untersuchungsausschuss“. In Folge der Berichterstattung von Cicero und dann weiterer Medien sei der 2. Untersuchungssauschuss des Deutschen Bundestages zur Klärung dieser Sachverhalte ins Leben gerufen worden.

Gräber erklärte, die Energiediskussion in Deutschland sei völlig überpolitisiert und der Diskurs werde im Stil eines Glaubenskrieges geführt. Er hält fest, dass sich im Untersuchungsausschuss zum Atomausstieg in den Zeugenbefragungen Fachbeamte offen von ihren Vorgesetzten distanziert hätten, die aus ihren Stellungnahmen und Empfehlungen das Gegenteil gemacht hätten.
Gräber warf die Frage auf, warum Deutschland auch jetzt diesen Weg des Atomaussteigs nicht verlassen könne und beantwortete sie mit der Wirkmächtigkeit des „Energiewendestaates“, wie ein Begriff von Frau Wendland laute, den er sich zu eigen mache, der wie ein grüner „Deep State“ funktioniere und alle wichtigen Positionen in der energiepolitischen Diskussion besetze.
Kernenergie und Koalitionsvertrag
Dr. Andreas Lenz MdB, der selbst in der Arbeitsgruppe Klima und Energie an den Koalitionsverhandlungen mitwirkte, berichtet in seinem Vortrag „Rückblick auf die Koalitionsverhandlungen“ über den Umgang mit der Kernenergie und die Perspektiven für die Kerntechnik, die in Deutschland gleichwohl bestehen.

Ausgehend von den Themen des parlamentarischen Untersuchungsausschusses, die vom vorherigen Redner Daniel Gräber angesprochen worden seien, erklärte Lenz, dass Schlüsselpositionen in den Ministerien für Wirtschaft und für Umwelt während der Energiekrise 2022/23 von Personen besetzt gewesen seien, für die ein Weiterbetrieb der Kernkraftwerke unvorstellbar gewesen sei. Wirtschaftsminister Habeck habe befürchten müssen, dass – selbst wenn er 2022 offener für eine Verlängerung des Betriebs gewesen wäre – er eine solche Position gegenüber Partei und Fraktion der Grünen nicht hätte durchsetzen können.
Lenz hielt fest, dass die Diskussionen im Untersuchungsausschuss und während der Koalitionsverhandlungen dazu beigetragen hätten, Fakten zum Thema Kernenergie in die Gesellschaft zu tragen. Er machte deutlich, dass die Grundlagen für die Wiederinbetriebnahme von Kernkraftwerken und größere Änderungen in der Abfallwirtschaftspolitik nicht im Rahmen der operativen Politik geändert werden könnten, weg von dem, was in den Koalitionsverhandlungen vereinbart worden sei. Er verwies auf die bestehenden Möglichkeiten im Bereich Forschung und Technologie in der Kernenergie, die genutzt werden könnten.
Lenz bedauerte, dass im Koalitionsvertrag eine große Chance vertan worden sei, wies aber darauf hin, dass sich die Haltung gegenüber Kernenergie in politischen Parteien, gesellschaftlichen Gruppen und der Öffentlichkeit insgesamt zum Besseren gewandelt habe. Er hob die Bedeutung hervor, die Entwicklung der Kernenergie international zu unterstützen, nicht zuletzt, um die Kompetenz im Bereich in Deutschland aufrechtzuerhalten und weil wir in Zukunft eine stabile Energiequelle benötigen würden.
Lenz unterstrich die Notwendigkeit einer neuen Forschungsagenda für die Kernenergie und befürwortete die mögliche Bildung von Kompetenzclustern im Bereich Kernenergie in Wissenschaft und Forschung.
Stand der Dinge: Kleinreaktoren
In seinem Vortrag „Kleinreaktoren – Chancen, Herausforderungen und aktuelle Entwicklungen berichtet Prof. Dr. Jörg Starflinger, Leiter des Instituts für Kernenergetik der Universität Stuttgart, dass im britischen SMR Tender noch zwei Anbieter übrig seien, der BWRX-300 von Hitachi/General Electric und der Rolls Royce SMR, wobei er es für wahrscheinlich halte, dass die britische Regierung am Ende dem heimischen Anbieter den Vorzug geben werde. Starflinger führt aus, dass man sich von SMR Vorteile bei der Sicherheit verspreche, wie passive Sicherheit, integrales Design bis hin zur Möglichkeit inhärenter Sicherheit, Vereinfachungen bei der Umsetzung der Projekte verspreche, wie eine reduzierte Komponentenzahl, die Möglichkeit der Fabrikherstellung integraler Module, Transportfähigkeit und eine verkürzte Bauzeit. Ebenfalls angestrebt würden die Co-Generation bzw. Nutzung von Wasserstoff oder Wärme, eine nochmals verbesserte Lastfolgefähigkeit und die Markterschließung auch für kleinere Stromnetze. Auch weiterhin würde nicht-waffenfähiges Material verwendet, wodurch Anforderungen zur Nicht-Proliferation erfüllt würden.

Starflinger erläutert, dass es 68 SMR-Designs verschiedener Art gebe: Landbasierte, wassergekühlte Systeme, seebasierte, wassergekühlte Systeme, gasgekühlte SMR, flüssigmetallgekühlte SMR mit schnellem Neutronenspektrum, Salzschmelze-SMR sowie Mikroreaktoren. In Betrieb befänden sich der KLT-40S der Akademik Lomonossov als seegestützter, wassergekühlter SMR in Russland sowie der HTR-PM als gasgekühlter, grafitmoderierter Kugelhaufenreaktor in China. In Bau befänden sich der landgestütze, wassergekühlte Reaktor CAREM in Argentinien und der bleigekühlte schnelle Reaktor BREST-OD-300 in Russland.
Starflinger teilt mit, dass es auf der Welt 19.000 unabhängige kleine Stromnetze gebe, von denen die Hälfte über 2 MW Leistung benötige, die heute mit Dieselgeneratoren bereitgestellt würden. Hier liege das weltweite Marktpotential für Micro Modular Reactors (MMR). Geografisch betrachtet lägen die Hauptmärkte für SMR in Asien, Nordamerika sowie ggf. in Polen, Tschechien, UK. Hinsichtlich der Marktperspektiven erklärt Starflinger, dass es bei SMR eine große Schwankungsbreite der Prognosen gebe, die von der Erwartung der Errichtung nur weniger Prototypenanlagen bis zu einem massiven Ausbau auf rund 9 Prozent der globalen Stromerzeugung reiche. Die Realisierung der Prototypen und die daraus resultierende mögliche Kostenabschätzung würden einen großen Einfluss auf den Erfolg haben.
Starflinger erläutert, dass die European Industrial Alliance on SMR der Ermittlung der vielversprechendsten und kosteneffizientesten SMR-Technologien, der Identifikation von Investitionshindernissen, der Analyse von Finanzierungsmöglichkeiten sowie der Identifikation potenzieller industrieller Nutzer mit energieintensiven Technologien dienen solle. Daraus soll der zukünftige Forschungsbedarf ermittelt werden und eine Grundlage für den Austausch zwischen Herstellern, mögl. Betreibern und europäischen Aufsichts- und Genehmigungsbehörden geschaffen werden.
Auf Nachfrage gibt Starflinger an, dass Kosten von den Entwicklern fast nie angegeben würden und er für fast alle Konzepte nicht über Kostenzahlen verfüge. Zu einer Frage nach bereits vorhandener Technologie im militärischen Bereich und deren Nutzung im zivilen Energiesektor erklärt Starflinger, dass diese Reaktoren in der Regel mit hoher Anreicherung betrieben würden, was im zivilen Sektor Probleme mit militärischer Geheimhaltung, Proliferation und IAEA-Regeln aufwerfen würde.
Stand der Dinge: Kernfusion
Prof. Dr. Robert Wolf vom Max-Planck-Institut für Plasmaphysik teilt in seinem Vortrag „Entwicklungsstand zur Kernfusion“ zu den technisch-wissenschaftlichen Grundlagen der Kernfusion zur Energiegewinnung u. a. mit, dass die schnellen Neutronen, die bei der Deuterium-Tritium-Fusion entstünden und oft als Problem betrachtet würden, gut für die Möglichkeit einer nutzbaren Energieauskopplung seien.

Wolf erklärte, dass eine vertiefte Kooperation mi der Industrie nicht nur als Auftragnehmer, sondern auch als Entwicklungspartner erforderlich sei, wenn man in Richtung der industriellen Anwendung der Fusionstechnologie vorankommen wolle.
Das Start-up-Projekt SPARC von Commonwealth Fusion Systems, für das Magnete mit der extrem hohen Magnetfeldstärke von 12,2 Tesla entwickelt würden und mit denen sich die Größe des Plasmas im Vergleich zum ITER deutlich reduzieren ließe – von 500 m³ für 500 MW(th) auf 20 m³ für 140 MW(th) – charakterisierte er als dem Space-X-Ansatz folgend, bei dem einfach ein neuer technischer Weg probiert würde, in der Hoffnung im Erfolgsfall damit viel Entwicklungszeit zu sparen.
Wolf gibt die Einschätzung, dass für eine zielgerichtete Entwicklung ein konsistentes Entwicklungsprogramm erforderlich sei, das alle Akteure einbeziehe und die Vermeidung von Kompetenzverlust zwischen Projekten gewährleiste, da dies bei den langen Zeiträumen der Entwicklung von Projekten und Folgeprojekten ein reales Problem sei. Wolf führt aus, dass für die Realisierung eines Kraftwerks in möglicherweise 20 Jahren ein serielles Vorgehen nicht ausreichend sei, sondern ein paralleles Vorgehen verwirklicht werden müsse, wie bei den Start-up-Unternehmen.
Zum geplanten Projekt DEMO als Demonstrator für ein kommerzielles Fusionskraftwerk erklärt Wolf auf eine Nachfrage, dass DEMO eine europäische Idee sei und sehr konservativ geplant werde. Konzepte von Start-ups mit stärkeren Magnetfeldern seien deutlich kleiner und könnten auch größere Impulse für andere Technologien/Hilfstechnologien leisten, etwa Hochtemperatursupraleiter und Laser.
Er erklärte, dass auch die Magnetfusion noch vor hohen technischen Deltas im Vergleich zu den Erfordernissen für ein Kraftwerk stehe, erst recht die Inertialfusion, die erst seit relativ kurzer Zeit als mögliche Energiequelle erforscht werde. Hier sei etwa die Herausforderung bei der Erhöhung der Einschussrate für Fusionstargets von 2 pro Tag auf 10 pro Sekunde für einen theoretischen Kraftwerksbetrieb zu nennen. Wolf berichtete, dass das Start-up Focused Energy zunächst kein Kraftwerk anstrebe, sondern eine Charakterisierungsanlage für radioaktive Abfälle mit Neutronenquelle.
Kernenergie in Tschechien
Zum Thema „Kernenergieprogramm der Tschechischen Republik“ sprach Lukáš Janura, Botschaftssekretär der Botschaft der Tschechischen Republik. Er berichtete vom 2022 begonnenen Ausschreibungsverfahren für geplante neue Kernkraftwerke, das zunächst auf eine Anlage am Standort Dukovany beschränkt gewesen sei und danach auf insgesamt vier Anlagen an beiden Standorten, Dukovany und Temelin ausgeweitet worden sei. Die Auswahl sei auf das Angebot des koreanischen Anbieters KHNP gefallen.

Janura erläutert, dass der Ausbau der Kernenergie ein wesentlicher Pfeiler der tschechischen Klimapolitik sei und erklärt, dass die Bedingungen sowohl für Fotovoltaik und insbesondere Windkraft in Tschechien im internationalen Vergleich nicht sehr günstig seien. Als Binnenland bestehe auch nicht die Möglichkeit der Nutzung von Windkraft auf See und aus Gründen der Energiesouveränität sei ein größerer Ausbau von Gaskraftwerken nicht angeraten.
Janura berichtet, dass auch der Einsatz und die Entwicklung von SMR verfolgt würden. Es gebe sowohl Konzepte in eigener Entwicklung, als auch eine Zusammenarbeit zwischen Rolls Royce SMR und dem tschechischen Elektrizitätsversorger CEZ, der einen Anteil an dem britischen Unternehmen erworben habe. Dabei spiele auch die Möglichkeit eine Rolle, dass kerntechnische Unternehmen in Tschechien Teil der Lieferkette werden könnten.
Uranversorgung weltweit
Unter dem Titel „Uran – Element der Zukunft“ berichtet der Geschäftsführer der Urenco Deutschland GmbH, Dr. Jörg Harren, über die Treiber des Wachstums der Kernenergie weltweit. Dies seien die Themen Klimawandel und Net-Zero-Politik, das Streben nach Energieunabhängigkeit sowie der wachsende Strombedarf durch den Ausbau von KI und die Elektrifizierung industrieller Prozesse.

Harren stellt fest, dass die Uranförderung und noch mehr die nachgewiesenen Uranreserven breit über die Welt gestreut seien und es daher zahlreiche heutige und zukünftige Lieferländer gebe. Die Anreicherung von Uran sei dabei ein zentraler Teil der Brennstofflieferkette und wesentlich weniger diversifiziert als die Förderung. So entfielen mehr als 40 Prozent der Anreicherungskapazität auf Russland, aber rund 28 Prozent des Bedarfs auf die Vereinigten Staaten, in denen es aktuell nur eine geringe Anreicherungskapazität gebe. Daraus ergebe sich das Bestreben, von Lieferungen aus Russland unabhängig zu werden, was für die Vereinigten Staaten zu einem Importverbot für russisches Uran ab 2028 geführt habe. In diesem Kontext seien die Preise für die Anreicherung nach der Invasion in der Ukraine sprunghaft gestiegen und es habe sich bei der Urenco-Gruppe ein starker Anstieg des Auftragsvolumens ergeben, das nun bis in die vierziger Jahre reichte.
Harren berichtet weiter, dass die Urenco-Gruppe darauf mit einem Kapazitätsprogramm reagiere, mit dem Kapazität erhalten, Ersatzkapazität geschaffen und Kapazitätserweiterungen vorbereitet werden sollen. Zugleich sei klar, dass die Uranreserven auch bei Nutzung aktueller konventioneller Technologie eine große Reichweite auch bei deutlicher Vergrößerung der Kernkraftkapazität hätten und sich die Reichweite durch Nutzung von Brutreaktoren und der aktuell noch unwirtschaftlichen Extraktion von Uran aus Meerwasser jeweils noch drastisch erhöhen lasse.
Er erklärt, dass die Urenco-Gruppe entschieden habe, die erste westliche kommerzielle Anlage für die Anreicherung von HALEU- Brennstoff mit Anreicherungsgraden bis maximal 19,75 Prozent zu errichten, wie er in verschiedenen SMR-Designs benötigt würde. Bereits in diesem Jahr werde die Lieferung von LEU+ Brennstoff beginnen, niedrig angereichertem Uran mit einem erweiterten maximalen Anreicherungsgrad von bis zu zehn, statt bisher maximal fünf Prozent.
In der das Programm abschließenden Podiumsdiskussion mit den Stellvertretenden Vorsitzenden von KernD, Carsten Haferkamp und Dr. Jörg Harren, stehen die persönlichen Erfahrungen der Panelteilnehmer Christine Bürger, Christel Plätzer und Marie-Therese Rupert aus Reihen der Young Professionals und Interessenten an der Kerntechnik im Mittelpunkt sowie ihre Zugänge zum Thema Kernenergie.

Der Vorsitzende von KernD, Thomas Seipolt beschließt die Veranstaltung mit der Einladung zum Get-together, bei dem wie bereits in den Kaffepausen und der Mittagspause von allen Anwesenden reger Gebrauch gemacht wird von der Möglichkeit zum informellen Austausch und zu weiterer fachlicher Diskussion mit den Referenten des Tages und untereinander in angenehmem Ambiente.
Fazit des Verbandstags
Der erste KernD-Verbandstag hat die in ihn gesetzten Erwartungen einer Vernetzungs- und Fachplattform für Industrie, Wissenschaft und Politik voll erfüllt und ist als Veranstaltungsformat geeignet, ein Schaufenster der kerntechnischen Branche in der Hauptstadt zu sein sowie der Kerntechnik in der Wahrnehmung der politischen Akteure mehr Präsenz zu verschaffen. Auch wenn eine rasche Rückkehr zur Kernkraftnutzung nicht zu erwarten ist, lohnt doch der Einsatz für den Verbleib technologischen und wissenschaftlichen Potentials der Kerntechnik in Deutschland. Der nachhaltige Stimmungsumschwung in der Bevölkerung und die größere Offenheit für die Kerntechnik in wichtigen Kabinettsressorts geben dafür im Augenblick Rückenwind.